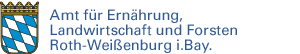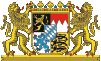Forstliche Gutachten
Waldverjüngung im Amtsbereich

© H.-J. Fünfstück/www.5erls-naturfotos.de
Die Bayerische Forstverwaltung hat im Jahr 2024 zum 14. Mal seit 1986 für die 35 Hegegemeinschaften im Amtsbereich Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung erstellt. Die Forstlichen Gutachten sind für die an der Abschussplanung Beteiligten ein wichtiges Hilfsmittel, um für die kommende Planungsperiode von 2025 bis 2028 gesetzeskonforme Abschusspläne für das Schalenwild aufzustellen.
Eine wesentliche Grundlage der Forstlichen Gutachten sind die Ergebnisse der im Frühjahr 2024 systematisch durchgeführten Verjüngungsinventur. Dazu haben die Försterinnen und Förster amtsweit an 1244 Verjüngungsflächen im Wald knapp 70000 junge Waldbäume auf Schalenwildeinfluss untersucht.
Laubholzanteil gestiegen
An 26 % der Flächen (zum Vergleich 17 % ist hier der bayerische Durchschnitt) konnten keine jungen Bäume aufgenommen werden, da sie komplett vor Schalenwild geschützt waren (Zäune). Damit ist der Anteil vollständig geschützter Flächen im Vergleich zu 2021 etwa gleichgeblieben, damals lag der Anteil bei 27 %, was auf eine hohe Verbissbelastung hinweist.
Bei der Verjüngungsinventur waren 37 % der aufgenommenen Bäume Buchen, 18 % Edellauholz wie Ahorn, Esche oder Kirsche, 14 % Fichten, 13 % Kiefern, jeweils 8 % Eichen und sonstige Laubbäume, 2 % Tannen. Der Anteil der Laubbäume in der Verjüngung hat sich zwar in den letzten Jahren erfreulich erhöht. Der Anteil der Nadelbäume ist entsprechend zurückgegangen. Aufgenommen wurden allerdings weit überwiegend Pflanzen aus Naturverjüngung, fast alle Pflanzungen und Saaten müssen geschützt werden.
Bei der Verjüngungsinventur waren 37 % der aufgenommenen Bäume Buchen, 18 % Edellauholz wie Ahorn, Esche oder Kirsche, 14 % Fichten, 13 % Kiefern, jeweils 8 % Eichen und sonstige Laubbäume, 2 % Tannen. Der Anteil der Laubbäume in der Verjüngung hat sich zwar in den letzten Jahren erfreulich erhöht. Der Anteil der Nadelbäume ist entsprechend zurückgegangen. Aufgenommen wurden allerdings weit überwiegend Pflanzen aus Naturverjüngung, fast alle Pflanzungen und Saaten müssen geschützt werden.
Der wichtigste Weiser für den Schalenwildeinfluss auf die Waldverjüngung ist der Anteil der Pflanzen mit frischem Leittriebverbiss beim Laubholz und hier zeigen sich in den 3 Landkreisen deutliche Unterschiede: Im Landkreis Roth liegt dieser Wert bei 27 % (2021: 26 %), in Weißenburg bei 20 % (2021: 20 %), dagegen waren im Nürnberger Land nur bei 13 % (2021: 13 %) die Leittriebe vom Schalenwild frisch verbissen.
Hohe Verbissbelastung
Wesentlicher Maßstab der gutachtlichen Beurteilung der Verjüngungssituation sind die jagdgesetzlichen Vorgaben des Art. 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bayerischen Jagdgesetzes. Diese können in den sogenannten „grünen“ Hegegemeinschaften erfüllt werden, für die die Forstlichen Gutachten die Verbisssituation als „tragbar“ oder „günstig“ werten. Nur in 12 von 35 Hegegemeinschaften wird die Verbisssituation als „tragbar“ gewertet (2021: 14), keine der Hegegemeinschaften gilt als „günstig“ (2021: keine). Eine zu hohe Verbissbelastung weisen 22 der Hegegemeinschaften auf (2021: 21) und in einer ist die Verbissbelastung sogar deutlich zu hoch (2021: keine). Insbesondere in den „roten“ Hegegemeinschaften sind weitere gemeinsame Anstrengungen von Waldbesitzern und Jägern notwendig, damit auch hier die jagdgesetzlichen Vorgaben erfüllt werden können.
Innerhalb der einzelnen Hegegemeinschaften gibt es häufig Unterschiede in der Verbisssituation. Zum Beispiel kann eine Hegegemeinschaft mit insgesamt tragbarer Verbisssituation neben „tragbaren“ Jagdrevieren auch Reviere umfassen, in denen die Verbissbelastung zu hoch ist, und solche, bei denen eine günstige Verbisssituation gegeben ist. Die Erstellung von ergänzenden Revierweisen Aussagen, die auf hohe Akzeptanz stoßen, trägt ganz wesentlich dazu bei, regionale Unterschiede in der Verbisssituation aufzuzeigen.
Empfehlungen der Forstverwaltung
Abgeleitet von der aktuellen Bewertung der Verjüngungssituation und unter besonderer Berücksichtigung ihrer zeitlichen Entwicklung gibt die Forstbehörde in den Forstlichen Gutachten Empfehlungen zur künftigen Abschusshöhe ab. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse der ergänzenden Revierweisen Aussagen in die Gesamtschau der Hegegemeinschaft mit ein. 2024 kann für 14 Hegegemeinschaften eine Beibehaltung auf dem Niveau des bisherigen Ist-Abschusses empfohlen werden. Für 21 Hegegemeinschaften lautet die Abschussempfehlung „erhöhen“.
In den „roten“ Bereichen (mit „zu hoher“ oder „deutlich zu hoher“ Verbissbelastung) sind deutlich verstärkte Bemühungen notwendig, damit sich auch hier die standortgemäßen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen natürlich verjüngen können. Das gilt insbesondere für die Hegegemeinschaften, die bereits über einen längeren Zeitraum, z. B. die letzten fünf Inventuren, durchgehend „rot“ waren. In dauerhaft roten Hegegemeinschaften ist der Fokus auf die Vollzugstätigkeit der Unteren Jagdbehörde und die Beratung im Jagdbeirat zu setzen.
Zusammenfassung
Die Entwicklung zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Deutliche Entmischungseffekte sind weiterhin erkennbar. In einigen Revieren hat sich die bisherige Abschussplanung als nicht geeignet erwiesen, um die Situation der Waldverjüngung zu verbessern. Als ein Mittel, die Situation zu ändern, erscheinen gemeinsame Jagdbegänge, bei denen alle Beteiligten (Vertreter der Grundeigentümer, Jäger, Jagd- und Forstbehörde) sich vor Ort ein Bild machen. Die Errichtung von Weiserzäunen in zumindest jedem „roten“ Jagdrevier kann zur Versachlichung der Diskussion beitragen. Zudem sind revierweise Aussagen in allen Revieren überlegenswert.