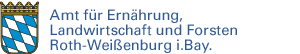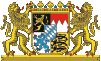Waldumbauoffensive
Musterbestände zum Waldumbau
Um vor allem privaten Waldbesitzenden einen besseren Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten des Waldumbaus zu ermöglichen, wurden vorbildlich bewirtschaftete Wälder aus Privat-, Staats- und Kommunalwaldbesitz im Amtsbereich mit guter Zukunftsprognose im Klimawandel gesucht und hier zusammengestellt. Viele dieser zukunftsweisenden Bestände zeigen, dass sich wertvolles Holz auch auf kleinen Waldflächen erzeugen lässt und gleichzeitig klimatolerante Bestände begründet werden können.
Gezeigt werden verschiedene Beispiele für einen gelungenen Waldumbau mit einem breiten Spektrum an alternativen Baumarten zu Fichte und Kiefer.
Musterbestände im Amtsbereich
Detailliere Karten inklusive Anfahrtsbeschreibungen finden Sie den jeweiligen Beständen angefügt. Nähere Informationen zu den einzelnen Beständen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht.
Lage der Bestände
Beispielbestände mit Rotbuche
Rotbuchen-Jungbestand im Privatwald bei Schnaittach
Vorangegangene Maßnahmen
Vor Beginn der Pflanzmaßnahmen wurde der alte Kiefernbestand moderat durchlichtet, um den jungen Buchen ausreichend Licht für ihr Wachstum zur Verfügung zu stellen. Nach der Pflanzung wurde in den ersten Jahren für die Jungpflanzen hinderlicher Begleitwuchs (v.a. Brombeere) entfernt. Pflanzenausfälle wurden ersetzt und einzelne grobe Vorwüchse (so genannte „Protzen“) entfernt, um den umliegenden Pflanzen das Mitwachsen zu ermöglichen. Damit auf lange Sicht hochwertiges Buchenholz entstehen kann, müssen in der frühen Phase des Bestandes die Bäumchen dicht an dicht stehen: „Dickung muss Dickung bleiben“ heißt hier der Leitspruch. Acht Jahre nach der Pflanzung wurde erneut im Altbestand nachgelichtet, um hiebsreife Kiefern zu nutzen und den Buchen weiterhin mehr Licht zu verschaffen. Einzelne gut geformte Kiefern wurden als so genannte „Überhälter“ stehen gelassen. Diese können weiter zuwachsen oder in Zukunft als Biotopbäume einen ökologischen Beitrag leisten.
Besonderheit
Für ihr noch junges Alter (zwischen 20 und 30 Jahren) sind die Rotbuchen vergleichsweise unterentwickelt. Das liegt vor allem an dem sehr armen Boden und auch an der vorhergehenden Überschirmung durch den Altbestand, bis dieser schließlich aufgelichtet wurde. Für die Einbringung der Buche ist dies ein Grenzstandort. Dennoch wächst sie und verbessert den Boden auf lange Sicht durch ihre nährstoffhaltige Laubstreu, welche sich am Boden zersetzen kann. Außer der Rotbuche sind nur wenige Baumarten für diesen armen Boden geeignet. Weitere Beispiele sind die Traubeneiche und Edelkastanie. Auch diese Baumarten wachsen hier langsam, sind aber in Hinblick auf den Klimawandel als zukunftsfähig zu bewerten!
Anfahrt
Aus Schnaittach auf der Simonshoferstraße Richtung Westen in den Wald fahren, dann unter der Autobahnunterführung hindurch. An der ersten Kreuzung befindet sich ein Wanderparkplatz. Hier bitte parken. An dieser Kreuzung den linken Forstweg nehmen. Diesem ca. 250 Meter folgen, bis er sich gabelt. An der Gabelung befindet sich auf der linken Seite der Musterbestand.
Lageplan - BayernAtlas 
Buchenvorbau unter Kiefer im Privatwald bei Kottensdorf
Vorangegangene Maßnahmen
Der jetzige Kiefern-Altbestand wurde 1957 in Reihenpflanzung begründet. 1993 wurde die Rotbuche unter den zuvor durchforsteten Kiefernbestand als Vorbau gepflanzt. Auf Grund der geringen Größe und der Ausformung der Fläche war der Bau eines Zaunes zum Schutz vor Wildverbiss notwendig gewesen.
Innerhalb der ersten drei Jahre der Buchenkultur mussten die jungen Pflanzen auf Teilen der Fläche von überwuchernder Brombeere konsequent befreit werden (Begleitwuchsregulierung). In den Folgejahren wurde etwa alle 5 Jahre zugunsten schöner Kiefern sehr mäßig durchforstet. Abgestorbene Kiefern wurden ebenfalls entnommen. Dies stabilisierte den Kiefernbestand und gab der Buche genug Licht zur Sicherung ihres Wachstums.
Besonderheit
Die guten Qualitäten der weitständig gepflanzten Buchen (2 x 1 Meter) resultieren hier aus der Überschattung durch den Kiefern-Altbestand. Als ausgeprägte Schattbaumart kommt die Buche mit dunkleren Gegebenheiten zurecht; auf Dauer benötigt aber auch sie ausreichend Licht im nicht im Dunkeln zu „verhocken“. Gute Qualitäten bei der Buche werden in der Regel über enge Pflanzabstände (1,5 x 1 Meter) erreicht, da die Pflanzen sich somit gegenseitig „pflegen“, das heißt, die Bildung von Ästen im unteren Stammbereich unterbinden.
Der Beispielbestand gliedert sich in das Gebiet des Waldumbauprojektes „Hennenberg“ ein. Über die „Initiative Zukunftswald Bayern“ wurden hier Fichten- und Kiefernbestände ausgewählt, um sie durch Waldumbaumaßnahmen fit für den Klimawandel zu machen. Hier können verschiedene Stadien des Waldumbaus hin zu ökonomisch und ökologisch wertvollen Wäldern betrachtet werden. Das Zusammenspiel vieler Waldbesitzer hat es ermöglicht, auf großen Pflanzflächen zeitgleich viele junge Bäume einzubringen. Somit konnte auf den Bau eines Zaunes verzichtet werden.
Anfahrt
Von Kottensdorf (Gemeinde Rohr) in Richtung Leitelshof befindet sich nach einem Kilometer auf der linken Seite die Beispielfläche. Eine Parkmöglichkeit finden Sie am Radweg, der den Forstweg an einer Baumgruppe mit Bank kreuzt. Zu Fuß geht es weiter bis zum Waldrand. An der Wald-Feldgrenze etwa 130 Meter nach links laufen. Bevor der Wald in eine Ackerfläche übergeht, haben Sie den Musterbestand erreicht.
Lageplan - BayernAtlas 
Rotbuchen-Altbestand im Kirchenwald bei Hersbruck
Vorangegangene Maßnahmen
In ihrer Jugend sind diese Buchen aus Naturverjüngung sehr dicht nebeneinander aufgewachsen. Lange, astfreie Stämme sind die Folge. Um gesunde und leistungsfähige Kronen zu bekommen, muss der Bestand konsequent gepflegt werden. Aktive Pflege kann in der Regel ab einem Alter von ca. 40 Jahren beginnen. Es wurden in diesem Zusammenhang die schönsten Buchen und Eschen (so genannte „Zielbäume“) in regelmäßigen Zeitabständen (10 Jahre) von den jeweils zwei stärksten Konkurrenten befreit. Der Abstand der Zielbäume zueinander sollte dabei etwa 10 Meter betragen.
Auf Grund notwendiger Maßnahmen zur Verkehrssicherung und der Entnahme absterbender Eschen (Eschentriebsterben) sind lückige Bereiche am Waldlehrpfad entstanden. Diese Lücken schließen sich nun zügig mit Jungbäumen aus den Samen von Ahorn und Buche.
Besonderheit
Auffällig sind die hier besonders hohen Buchen mit sehr langem astfreien Stammabschnitt von teilweise bis zu 15 Metern. Der gut mit Nährstoffen versorgte Boden aus Eisensandstein bildet hierfür die Grundlage. Die sehr langen astreinen Stämme sind auf die dichte Naturverjüngung und den engen Standraum zu Beginn der Bestandesgeschichte zurückzuführen.
Die für die Artenvielfalt wertvollen Biotopbäume mit Spechthöhlen oder Spalten für Fledermäuse werden gezielt erhalten. Das Eschentriebsterben (Pilz, Verbreitung über den Wind) befällt nur Eschen. Eine äußerst geringe Prozentzahl dieser Baumart zeigt sich gelegentlich als resistent. Diese gilt es, sowie die öffentlichen Belange der Verkehrssicherheit es gestatten, zu erhalten. Der absolute Großteil der Eschen stirbt allerdings auf lange Sicht ab.
Anfahrt
Die Waldfläche liegt im Osten Hersbrucks am Steinberg. Sie ist von der Amberger Straße am besten über die Buchstraße, dann über die Straße „Am Buch“ und die Königsberger Straße zu erreichen. Hier bitte parken und zu Fuß dem Feld-/Waldweg in Richtung Buchbrünnlein folgen. Nach etwa 500 Meter sind Sie am Musterbestand.
Lageplan - BayernAtlas 
Laubmischwald bei Weißenburg
Bestandesbeschreibung
Der Bestand stockt auf einer Gesamtfläche von ca. 4,9 Hektar. Bestandesbildend sind hier die Baumarten Rotbuche, Stieleiche, Roteiche und Esche. Einzeln beigemischt sind Hainbuche, Bergulme sowie Feldahorn und Spitzahorn vorzufinden.
Der gesamte Bestand weist einen hohen Strukturreichtum auf, sowohl in Hinblick auf das Alter als auch die Höhenverteilung der Bäume. Die Spreizung des Bestandesalter erstreckt sich somit über eine große Spannweite von ca. 20 - 185 Jahren. Aufgrund der kleinflächigen, räumlichen Strukturveränderungen im Bestandesgefüge ist auf der Fläche vielerorts bereits Vorausverjüngung aus Rotbuche, Stieleiche und Bergahorn vorzufinden.
Auf der gesamten Fläche konnten in der Vergangenheit bereits hohe Totholz-Anteile angereichert werden. Neben der ausgeprägten ökologischen Bedeutung des Bestandes erfüllt er insbesondere für die Besucher des Weißenburger Stadtwaldes die Funktion eines wichtigen Naherholungswaldes.
Vorangegangene Maßnahmen
In der Vergangenheit wurden im Rahmen einzelner Sanitärhiebe kränkelnde und absterbende Einzelbäumen vor dem Hintergrund des Waldschutzes entnommen. In Hinblick auf die Verkehrssicherungspflichten des Waldeigentümers konzentrierten sich diese Entnahmen besonders auf die Randbereich der Wege.
Weitere schwache Durchforstungseingriffe, vorwiegend in der Buche, dienten dazu, vitaleren Einzelbäumen mehr Platz zur Ausbildung der Krone zu ermöglichen.
Als Beitrag zur ökologischen Funktion des Bestandes verbleiben Teilmengen des Holzes als liegendes Totholz auf der Fläche und bieten somit Lebensraum für unter anderem Pilze und Insekten.
Zukünftige Maßnahmen
Im weiteren Verlauf wird durch Einzelentnahmen fortwährend sowohl der Strukturreichtum des Bestandes als auch der Totholzanteil auf der Fläche erhalten und gefördert. Zugleich soll auf jüngeren Bestandesflächen eine Pflege durchgeführt werden, deren Ziel die Herausbildung von vitalen Zukunftsbäumen ist.
Anfahrt
Von Weißenburg kommend Richtung Rothenstein (Osten) der Landstraße folgen, nach 3 Kilometern links (Süden) in die ausgebaute Straße einbiegen. Dieser ca. 450 Metern nach Süden folgen, dann rechts (Nord-West) in den Forstweg einbiegen. Hier bitte am Wanderparkplatz „Thäleinschlag“ parken. Nach 400 Metern der Forststraße „Römerbrunnen“ folgend liegt der Musterbestand auf der rechten Seite.
Lageplan - BayernAtlas 
Buchenvorbaugruppen verschiedenen Alters bei Weißenburg
Bestandesbeschreibung
In diesem Waldstück der Waldgenossenschaft Pfraunfeld sind in engem räumlichen Zusammenhang Buchenvoranbauten verschiedenen Alters vorzufinden. Unter einem aufgelichteten Fichtenbestand, welcher stark von Hallimasch (holzzerstörender Pilz) befallen ist, wurde auf ca, 0,45 Hektar Rotbuche vorgebaut.
Im südlichen Teil der Fläche haben hier schon Freiflächenbedingungen geherrscht, was eine kompliziertere Anwuchsphase, einhergehend mit Mäuseschäden, Ausfällen und entsprechenden Nachbesserungen (z. T. mit Lärche) zur Folge hatte.
Besonderheiten
Beim Waldumbau von Fichtenwäldern zu klimaresistenten Mischwäldern ist der Vorbau mit Buche und Tanne unter einem Altholzschirm das Mittel der Wahl: Nach der Ernte von einzelnen Fichten aus dem Altbestand werden die jungen Buchen und Tannen angepflanzt. Durch die verbliebenen Alt-Fichten bleibt ein Waldinnenklima erhalten, das die nächste Waldgeneration vor (Spät-) Frösten, Hitze, Verunkrautung und Vergrasung schützt.
Als ausgeprägte Schattbaumarten kommen Buchen und Tannen, besonders in den jungen Jahren zwar mit wenig Licht aus, sind in ihrer Entwicklung allerdings durch die Konkurrenz der Altbäume in Hinblick auf Ressourcenverfügbarkeit wie Wasser, eingeschränkt. Momentan spendet der Altbestand der Fichten zwar noch Schatten zur Anregung der Selbstdifferenzierung von Buche und Tanne, sowie auch ein schützendes Waldinnenklima. Auf Dauer müssen allerdings kontinuierlich Fichten aus dem Schirm entnommen werden. Somit wird sichergestellt, dass die Verjüngung nach und nach mehr Zugang zu den überlebenswichtigen Ressourcen Licht und Wasser, aber auch Wärme und Platz, bekommt. Nach 20 bis 30 Jahren können die letzten Altfichten entfernt werden und der Umbau des Bestandes ist abgeschlossen.
Vorangegangene Maßnahmen
Der Pflanzverband von 1 x 1,2 Meter wurde mit über 8000 Pflanzen pro Hektar sehr dicht gewählt, trägt aber in der Dickungsphase zu einer besseren Astreinigung bei. Trotz der anfänglichen lockeren Überschirmung war es notwendig, die Kultur regelmäßig auszugrasen. Als die Kultur aus der Verbisshöhe herausgewachsen war, konnte der Zaun (Schutz vor Wildverbiss) abgebaut und an anderer Stelle wiederverwendet werden.
Anschließend wurde über den Vorbauten durch Entnahme der Fichten nachgelichtet und 2012 konnte schließlich der Restschirm geräumt werden, ohne dabei große Schäden an der Jungkultur zu verursachen. Die bei dieser Holzernte entstandenen Stöcke der Fichten sind auch heute noch teilweise auf der Fläche sichtbar.
Anfahrt
Aus Pfraunfeld kommend in Indernbuch links abbiegen in den Kirchenmauerweg, dann links in den Wasserweg abbiegen, diesem bis in den Wald folgen. Nach 250 Metern sind die Vorbaugruppen bereits vom Weg aus erkennbar.
Lageplan - BayernAtlas 
Beispielbestände mit Eiche
Eichenhähersaat unter Kiefernschirm im Stadtwald Lauf an der Pegnitz
Vorangegangene Maßnahmen
Über eine kontinuierliche und mäßige Durchforstung konnten im vorliegenden Bestand stabile und vitale Kiefern erzeugt werden. Im Gegensatz dazu bilden die Kiefern in den häufig zu dicht stehenden Kiefernbeständen nur kleine Kronen und sehr schlanke Stämme aus, trotz ihr sehr hohen Alters. Solche Kiefern sind in der Jugend schneebruchgefährdet, treten in starke Konkurrenz zueinander und zeigen weniger Zuwachs.
Die Naturverjüngung der Eiche hat sich hier nach und nach eingestellt und ist auf den Eichelhäher zurückzuführen. Um neben der Eiche eine weitere klimatolerante Baumart einzubringen und ihr zudem einen so genannten dienenden „Nebenbestand“ zu geben, wurde 2019 auf dem nährstoffarmen Boden hier die Rotbuche gepflanzt. Die Buche ist als ökologische Beimischung und als dienende Baumart zur Eiche gut geeignet. Der Pflanzabstand wurde mit 3 x 3 Metern weit gewählt, um unnötige Kulturkosten zu sparen.
Besonderheit
Die Nähe zum Staatswald und die somit gute Jagdsituation war hier der Schlüssel zum Erfolg. Nur mit einem so gut angepassten und somit gesunden Schalenwildbestand konnte sich die Eichenverjüngung ohne teuren Zaun etablieren und auch überhaupt entwickeln. Die Buchenergänzungspflanzung dient in erster Linie dazu, durch seitliche Beschattung den Eichen bessere Stammqualitäten zu ermöglichen. Weiterhin gilt die Rotbuche als eine anspruchslose, heimische Baumart, die auch mit dem Klimawandel gut zurechtkommen wird. Darüber hinaus stellt sich der Effekt eines Mischwaldes ein: er streut und senkt in Zeiten der Klimaerwärmung das Betriebsrisiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Baumarten mit dem Klimawandel nicht zurechtkommen, ist somit eher gering..
Anfahrt
Von Lauf kommend Richtung Ottensoos (Ottensooser Straße) halten. Nach ca. 1 km rechts durch die Bahnunterführung Richtung Schönberg fahren. Nach etwa 600 Metern, kurz bevor die Wiese beginnt, befindet sich der Musterbestand links.
Lageplan - BayernAtlas 
Erstaufforstung mit Eiche und Ahorn im Privatwald bei Offenhausen
Vorangegangene Maßnahmen
Die Waldbesitzer begründeten die Erstaufforstung über eine Eichensaat (1.700 kg Eicheln für 2,5 Hektar). Der Boden wurde zu diesem Zweck mit einer Fräse am Ackerschlepper im Abstand von 1,20 Metern in Reihen bearbeitet. Es wurde darauf geachtet, die Eicheln nicht zu tief (2-5 Centimeter) einzuarbeiten. Zum Schutz vor Schalenwild musste man einen Zaun aufstellen. Neben einer Mäusebekämpfung wurden die Jungpflanzen auch vor dem Überwachsen mit Begleitvegetation geschützt. Hierzu wurden die am schlimmsten betroffenen Bereiche mit dem Freischneider von Gras befreit.
Als die Jungeichen etwa 1,5 - 2 Meter Höhe erreicht hatten, wurde ein so genannter „Zwieselschnitt“ durchgeführt. Ausgefallene Eichen wurden mit Rotbuchen Bergahorn und Tannen ersetzt. Die restlichen Mischbaumarten (Kirsche, Walnuss, Esche) sind von selbst aufgegangen.
Ab einem Bestandsalter von etwa 10 Jahren wurden einzelne grobe Vorwüchse („Protzen“) entnommen. Auch begann man eine moderate Pflege zugunsten gut geformter Eichen. Beim Ahorn und den Kirschen wurden etwas mehr Konkurrenten (1-3) entnommen – hier besteht nicht die Gefahr einer Wasserreiserbildung am besonnten Stamm wie bei der Eiche. Bis ins Jahr 2016 hat man die vitalsten Bäume Stück für Stück auf 8 Meter Schaftlänge geastet. 2018 fand die Anlage der ersten Rückegassen statt.
Besonderheit
Zu beachten:
Bevor eine Erstaufforstung durchgeführt werden kann, muss eine Erlaubnis bei der zuständigen unteren Forstbehörde (AELF) beantragt werden.
Viele Waldbauliche Maßnahmen, wie die Begründung oder Pflege Ihres Waldes können über die Forstverwaltung finanziell gefördert werden. Ihre örtlich zuständigen Revierleitenden der Forstverwaltung beraten Sie gerne.
Anfahrt
Die Erstaufforstung befindet sich von Offenhausen (Nürnberger Land) in Richtung Schrotsdorf auf östlicher (linker) Seite der Landstraße (Lau 5). Zwischen Hallershof und Schrotsdorf geht ein ausgebauter Feldweg von der Landstraße Richtung Wald ab. Diesem 400 Meter bis zum Beispielbestand in einer Linkskurve folgen.
Lageplan - BayernAtlas 
Eiche mit Hainbuche und Rotbuche im Privatwald bei Heideck
Vorangegangene Maßnahmen
Vor Beginn der Pflanzmaßnahmen musste ein Wildschutzzaun aufgestellt werden. Im ersten Jahr der Kultur wurde eine Mäusebekämpfung zum Schutz vor Fraßschäden an den Wurzeln durchgeführt und Teile der Fläche ausgemäht (Begleitwuchsregulierung). Im dritten Jahr hat die Familie nicht angewachsene Pflanzen ersetzt. Sonstige Eingriffe beschränkten sich dann auf die Entnahme einzelner vorwüchsiger, krummer Bäumchen (so genannter „Protzen“).
Die Eiche braucht zunächst sehr dichte Bestände, um gerade und feinastig aufzuwachsen. Dabei darf aber auch das Licht von oben nicht fehlen, denn sie ist eine ausgeprägt Lichtbaumart.
Damit jeder „Zielbaum“ zukünftig optimal gepflegt wird, wurde anschließend alle 7-10 Meter die jeweils beste Eiche farbig markiert. Diese vitalen, geraden und geringastigen Eichen wurden daraufhin etwa alle 3 Jahre von einem Konkurrenten, der in die Krone des Zielbaumes einwächst und dort stört, befreit. In den Bereichen zwischen den Zielbäumen finden keine Maßnahmen statt.
Besonderheit
Oft wird zu wenig Nebenbestand gepflanzt und die Aufgabe der Stammbeschattung der Eiche kann auf längere Sicht nicht gewährleistet werden. In diesem Beispiel wurden Eiche und Nebenbestand in einem Verhältnis von 1:1 gepflanzt. Die ständige Arbeit ausschließlich am Zielbaum verhindert, dass der Nebenbestand zu viel Licht bekommt, da dieser sonst über die Eichen wachsen würde und entnommen werden müsste.
Anfahrt
Der Musterbestand befindet sich von Heideck (Selingstadt) kommend Richtung Alfershausen im Waldgebiet Thann. Vor dem Waldstück rechter Hand kann am Feldweg an der Wiese geparkt werden. Dem Forstweg bis zur Linkskurve folgen. Hier geht ein Rückeweg geradewegs zum Bestand. Dieser befindet sich nach 160 Metern rechts.
Lageplan - BayernAtlas 
Eiche-Hainbuche im Stadtwald Spalt
Vorangegangene Maßnahmen
Nach der Dickungsphase (bis ca. 12 Meter Höhe) wurden die besten Bestandsglieder kontinuierlich durch Herausnahme von Hainbuchen gefördert. Alle 5 Jahre wurden ein bis zwei Konkurrenten je qualitativ hochwertigem Baum („Zielbaum“) entfernt. Es wurden nicht zu viel Bedränger auf einmal entfernt, da sonst die Gefahr von Wasserreiserbildung bestanden hätte. Eichen bilden diese aus, wenn der Stamm nicht mehr beschattet wird und zu viel Licht bekommt. Äste und Wasserreiser vermindern die Holzqualität.
Eine gewisse Kronenspannung muss zudem erhalten bleiben, solange die gewünschte astfreie Stammlänge noch nicht erreicht ist (etwa 1/3 der Endhöhe des Baumes). Ein Mindestabstand der Zielbäume von 8 - 12 Metern sollte nicht unterschritten werden. In den Feldern zwischen den Zielbäumen finden keine Maßnahmen statt. Nachdem die Astreinigung vollzogen ist (ca. 6 - 9 Meter Schaftlänge), werden alle 5-10 Jahre ein bis zwei Bedränger je Zielbaum entnommen.
Besonderheit
Der sehr füllige Nebenbestand aus Naturverjüngung der Hainbuche ist hier ein großer Vorteil. Er besteht darin, dass der wertvolle Eichenstamm von Beginn an wenig Licht bekommt. So ist es möglich, sehr astreine Eichenstämme heranwachsen zu lassen – denn fehlerloses Holz ist besonders gefragt!
Auch die Tatsache, dass vergleichsweise wenige Eichen in direkter Konkurrenz zueinander stehen, ist für die Kronenentwicklung förderlich. Schnelles Durchmesserwachstum wird so durch eine große Krone ermöglicht: stehen viele Bäume dicht aneinander, können sie nur in die Höhe wachsen, bleiben aber schmal – steht hingegen ausreichend Platz zur Verfügung, können auch starke Kronen ausgebildet werden, was sich direkt in einem höherem Dickenzuwachs niederschlägt.
Anfahrt
Fahren Sie von Spalt in Richtung Absberg, dann an Stockheim vorbei. Gleich danach auf rechter Seite biegen Sie in den Feldweg ein. Hier kann am Rand geparkt werden. Laufen Sie über die Wiese, wie in der Skizze mit braun dargestellt. In blau der vorgestellte Wald. Der Großteil der Eichen konzertiert sich auf die Hangseite des Bestandes, am Oberhang finden sich hauptsächlich Hainbuchen.
Lageplan - BayernAtlas 
Eiche-Fichte-Kiefer im Privatwald bei Thalmässing
Vorangegangene Maßnahmen
Die besten und vitalsten Bäume wurden seit 1980 stetig von den ärgsten Konkurrenten befreit. Diese permanente, aber leichte Förderung der „Zielbäume“ verursacht einen gleichmäßigen Jahrringaufbau, der die Holzeigenschaften verbessert. Der Unterstand (jüngere und schwächere Bäume) wurde zugunsten einer besseren Astreinigung der Eichenstämme belassen. Die permanente Beschattung der Eichenstämme fördert das Wachstum astreinen Stammholzes.
Besonderheit
Eiche wird schon seit einigen Jahren auf dem Holzmarkt sehr gut und mit hohen Preisen nachgefragt. Auch nicht ganz perfekte Stämme erzielen sehr gute Preise. Die teils gute bis sehr gute Qualität der Eichenstämme ist auf den ehemaligen Fichtennebenbestand zurückzuführen. Die jüngeren Fichten wuchsen als Naturverjüngung unter den älteren Eichen empor. Die Eichenstämme wurden durch die kleineren Fichten beschattet. Ungewollte Äste am Eichenstamm wurden so ausgedunkelt und starben frühzeitig ab. Fichten, die in die Eichenkrone hineinwuchsen wurden entfernt, um den Eichen Platz und Licht zu geben. Mit breiten, vitalen Kronen und zeitgleich beschatteten Stämmen lassen sich vergleichsweise schnell (in 80 bis 120 Jahren) qualitativ hochwertige und ausreichend starke Stämme erziehen.
Anfahrt
Gleich nach Alfershausen (Richtung Thalmässing) befindet sich auf der rechten Seite vor der Kläranlage ein Feldweg Richtung Süden. Diesem folgen Sie etwa 1 km bis zum Wald. Hier bitte parken. Nehmen Sie den mittleren Forstweg in den Wald und folgen ihm 300 Meter, dann rechts halten. Nach 200 Metern befindet sich der Musterbestand rechts.
Lageplan - BayernAtlas 
Hochwertiger Eichenbestand mit Hainbuche bei Hersbruck
Vorangegangene Maßnahmen
Der Bestand wurde zu Beginn erst als Mittelwald bewirtschaftet. Das heiß, in 30-jährigem Intervall wurde das Unterholz aus Hainbuche (heutiger Nebenbestand) als Brennholz geerntet. Die Eichen blieben zum Ausreifen stehen. Die Hainbuchen bildeten Stockausschläge und trieben erneut aus den Wurzelstöcken aus. Die Eichenstämme wurden so permanent durch das Hainbuchenunterholz beschattet und bildeten astfreies, wertvolles Stammholz. In den letzten 40 Jahren wurden zwei Zielstamm-orientierte Durchforstungen durchgeführt. Dabei wurden die wertvollsten und vitalsten Eichen von den jeweils stärksten Konkurrenten befreit.
Besonderheit
Schon im Mittelalter haben sich die Menschen über das Unter- und Hauptholz der Mittelwälder mit Energie- und Bauholz versorgt. Die Form der Mittelwaldbewirtschaftung hat im letzten Jahrhundert stark an Bedeutung verloren. Nur noch 1 % Bayerns Wälder sind als Mittelwälder erhalten geblieben. Diese Art der sehr aktiven Waldbewirtschaftung bewirkt vielfältige, strukturreiche Wälder und erzeugt einen der artenreichsten Waldlebensräume. Durch die wiederkehrende Entnahme des kompletten Unterholzes entsteht ein heller und warmer Lebensraum, der so von seltenen Tier- und Pflanzenarten besiedelt werden kann.
Anfahrt
Der Musterbestand befindet sich im Norden von Altensittenbach (Hersbruck), bzw. westlich von Kühnhofen. Nehmen Sie nach dem Altensittenbacher Ortsausgang auf der Kühnhofener Str. die erste Abzweigung links zur Gaststätte Fuchsau. An der Fuchsau bitte parken. Folgen Sie dem Forstweg etwa 500 Meter bis zum Musterbestand auf der rechten Seite.
Lageplan BayernAtlas 
Roteiche-Traubeneiche-Rotbuche Mischwald im Staatswald bei Oberhöhberg
Bestandesbeschreibung
Der Bestand erstreckt sich über ca. 1,98 Hektar. Es handelt sich um einen Laubmischwald mit einzelnen Waldkiefern und Fichten. Zu den hier auftretenden heimischen Laubbaumarten, unter anderem Traubeneiche, Rotbuche und Hainbuche, kommt hier die amerikanische Roteiche vor. Gerade die Roteiche weist hier bereits hohe Stammqualitäten auf und ist für diese Region in dieser Altersstruktur (45-70 Jahre) eine absolute Seltenheit.
Der Bestand ist punktuell bereits mit Bergahorn und einzelnen Hainbuchen vorausverjüngt. Aufgrund des hohen Laubholzanteils ist der Bestand bereits mit stehendem und liegendem Totholz angereichert und somit ist ihm hier eine hohe ökologische Funktion anzurechnen. Der Wald ist gemeinsam mit den umliegenden Beständen als Erholungswald der Intensitätsstufe 1 eingeordnet.
Vorangegangene Maßnahmen
Die Trockenheit und Borkenkäferbefälle der letzten Jahre führten zur nahezu gänzlichen Entnahme der Fichten. Ebenso mussten vereinzelt geschädigte Kiefern mit Trockenschäden entnommen werden. Um im Gesamtbestand mehr Platz für Kronen einiger vitaler Laubbäme zu schaffen, wurde vorsichtig mit einzelnen Pflegemaßnahmen eingegriffen.
Zukünftige Maßnahmen
In den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass sich die Fichten und Kiefern gänzlich aus dem Bestandesbild verabschieden werden. Infolgedessen werden vereinzelt Waldschutzeingriffe nötig sein. Weiterhin werden auch wieder Pflegeeingriffe im Laubholz durchgeführt, um vitale, stabilisierende Baumkronen zu erziehen.
Anfahrt
Von Oberhöhberg Richtung Haundorf kommend, bevor man in den Wald einfährt (ca. 700 Meter westlich von Oberhöhberg), an der linken Waldrandkante nach ca. 20 Metern gelegen. Etwa 20 Meter auf der gegenüber liegender Straßenseite findet sich ein kleiner Parkplatz.
Lageplan - BayernAtlas 
Voranbau von Traubeneiche und Roteiche unter Kiefer bei Pleinfeld
Vorangegangene Maßnahmen
Im Winter 2011/2012 wurde die Kiefer hier kräftig durchforstet und im Frühjahr 2012 mit Traubeneiche im Pflanzverband 1,8 x 1 Meter und mit Roteiche im Pflanzverband 2 x 1,3 Meter unterpflanzt, jeweils mit Hainbuchen-Nebenbestand, jede 10. Pflanze. Zum Schutz vor Wildschäden musste hier ein Zaun errichtet werden.
Besonderheiten
Bei der Maßnahme wurde besonderes Augenmerk auf die Anlage der Feinerschließung und der Kultur gelegt:
- Systematisch angelegte Rückegassen im Abstand von ca. 35 m.
- Keine Bepflanzung von 5 Meter breiten Fällstreifen entlang der Rückegassen und der parallel verlaufenden Zaunlinien. Bei späteren Holzerntemaßnahmen können somit die Kronen der Kiefern auf die Rückegassen und die Fällstreifen geworfen und so Schäden an der Kultur und dem Zaun vermieden werden.
- Einbau von Zauntoren am Anfang und Ende jeder Rückegasse, um den Ab- und Aufbau des Zauns bei zukünftigen Nachlichtungshieben zu vermeiden.
Durch die begleitende Bodenverwundung bei der Holzernte konnte sich außerdem Kiefern-Naturverjüngung ansamen, die auf diese Weise ihre Beteiligung an der Folgegeneration findet.
Zukünftige Maßnahmen
In Zukunft wird man über den Voranbauten im Altbestand nachlichten – sowohl um die Kronen der Kiefer gesund und leistungsfähig zu halten als auch um für die Eichen-Vorbauten stets die besten Wuchsbedingungen gewährleisten zu können. Da bei der Pflanzung auf eine durchdachte Planung gesetzt wurde, kann hier problemlos weiter geerntet werden, ohne die Eichen-Kultur dabei zu beschädigen.
Der Wald wurde hier durch die Beteiligung von Laubholz aufgewertet, damit in der folgenden Generation mit einer Mischung aus Eiche, Kiefer und Hainbuche weitergearbeitet werden kann. Sowohl das ökologische als auch das finanzielle Risiko wird dadurch auf mehrere Baumarten verteilt und ein stabiler Mischbestand geschaffen.
Anfahrt
Auf der Stirner Straße von Pleinfeld Richtung Stirn rechts abbiegen Richtung Gunzenhausen. Nach ca. 350 Metern links in einen Feldweg fahren bis zum Hinweisschild am Waldrand. Dort dem Erdweg folgen bis auf der rechten Seite im Bestand die Schautafel steht.
Lageplan - BayernAtlas 
Zerreichen-Bestand im Stadtwald Greding - Forschungsobjekt
Bestandesbeschreibung
Bei dem vorliegendem Eichenbestand handelt aus sich um eine 50 – 60-jährige Kultur, welche aus Saat hervorgegangen ist. Auf einem Hektar Fläche, hier im Stadtwald Greding, finden sich etwa 200 Baum-Individuen, der Großteil davon sind Zerreichen, eine mediterrane Baumart. Der Bestand ist zusätzlich durchsetzt mit Linden, Buchen, einzelnen Kiefern und Lärchen, schwächelnden Fichten, sowie auch der heimischen Traubeneiche an den Bestandesrändern. Die Zerreichen weisen eine gute Vitalität auf, die Stabilität der einzelnen Bäume sowie des Bestands insgesamt ist ebenso als gut einzuschätzen. Lediglich die Qualitäten der Zerreiche weisen teilweise Mängel auf, zu erkennen an Wasserreisern, die sich auf Grund starker Sonneneinstrahlung am Stamm gebildet haben.
Auf der südlichsten Teilfläche (ohne Zaun) finden sich jedoch einzelne qualitativ gut bis sehr gut ausgeprägte Individuen. Der Bestand stock auf dem südlichen Zipfel eines vorgeschichtlichen Bestattungsplatzes mit überwiegend verebneten Grabhügeln.
Die Eichenflächen wurden zum Großteil umzäunt, dies soll dafür sorgen, dass hier, in einem Bereich mit hoher Verbissbelastung, eine neue Baumgeneration aus Naturverjüngung entstehen kann.
Besonderheiten
Im Rahmen einer Masterarbeit der Technischen Universität München (TUM) wurden im Jahr 2022 15 der ca. 200 Individuen mittels sogenannter Kernbohrungen beprobt. Durch den Vergleich mit Bohrungen aus anderen Zerreichenbeständen in Bayern konnten unter anderem neue Erkenntnisse über die Reaktion der Zerreiche auf längere Trockenperioden gewonnen werden.
Es hat sich gezeigt, dass die Zerreiche, im Vergleich zur heimischen Traubeneiche, sensibel auf Witterungs- und Klimaveränderungen reagiert. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass sie im Verlauf anhaltender Trockenperioden zunächst ihr Wachstum auf ein Mindestmaß begrenzt, um nicht unnötig geschwächt zu werden. Ist die Trockenperiode vorbei, kann sie allerdings wieder im selben Maß wie zuvor weiterwachsen. Sie erleidet dadurch keine bleibenden Schäden, solange die Trockenperioden nicht in übermäßigem Maße anhalten, denn eine Baumart der Steppen und Wüsten ist sie nicht. Bedingt durch ihre auffallend hohe Wurzelenergie ist sie dazu in der Lage auch besonders schwere Tonböden, wie es hier der Fall ist, zu erschließen und sich auf besonders schwierigen Standorten zu behaupten. Somit stellt sie in Hinblick auf den Walderhalt in Problemgebieten oder als ökologische Beimischung eine besonders interessante Wahl für die Zukunft dar.
In ihrer Wuchsleistung ist sie der Traubeneiche deutlich überlegen. Allerdings erreicht sie dabei nicht vergleichbare Holzqualitäten. Dies zeigt sich auch darin, dass sie in Italien, einem ihrer Herkunftsländer, in erster Linie in Nieder- und Mittelwäldern bewirtschaftet wird, das heißt, die Gewinnung von Energieholz steht dort oft im Vordergrund.
Die Zerreiche stellt als Baumart des Mittelmeerraumes eine interessante Ergänzung unseres Baumartenportfolios dar, welche auch unter mitteleuropäischen Bedingungen gute Wuchsergebnisse vorweisen kann. Allerdings ist sie nicht als Ersatz zur heimischen Trauben- oder Stieleiche zu sehen, denn die Baumarten unterscheiden sich doch deutlich voneinander.
Zukünftige Maßnahmen
Im weiteren Verlauf des Bestandeslebens wird die Zerreiche hier zunächst ihrem Dickenwachstum überlassen. Das heißt, nur absolut notwendige Entnahmen im bereits lichteren Nebenbestand zum weiteren Ausbau der Kronen. Zudem bietet es sich an, hier hinter Zaun einen neuen Nebenbestand einzubringen, da der momentane Nebenbestand bereits weitestgehend in den Kronenraum der Eichen eingedrungen ist. Besonders geeignet dafür wäre die Hainbuche, da diese gut mit den schweren Tonböden und der zu erwartenden Staunässe umgehen kann. Als stark durch Wildverbiss gefährdete Baumart benötigt sie jedoch einen Wildschutzzaun.
Anfahrt
Fahren Sie von Greding aus Richtung Westen, unter der Autobahnunterführung durch und den Berg hinauf der Serpentine folgend in Richtung Kraftsbuch. Etwa 500 Meter vor Kraftsbuch befindet sich rechter Hand (Norden) eine Parkmöglichkeit von welcher aus Sie der Straße folgend (Achtung gelegentlicher Verkehr) der Straße in Richtung Greding 200 Meter folgend und schließlich nach Süden in den Feldweg einbiegen. Wenn Sie diesem weitere 250 Meter folgen, finden sie zu Ihrer Rechten die Zerreichen-Fläche. Wahlweise können Sie auch 300 Meter vor Kraftsbuch nach Süden in den Forstweg einbiegen, das Auto am Rand parken (Durchfahrt ermöglichen) und dem Forstweg 300 Meter nach Süden folgen, dann dort links in Richtung Greding abbiegen und nach weiteren 100 Metern erreichen Sie die Zerreichen-Fläche.
Lageplan - BayernAtlas 
Forschungsergebnisse Zerreichen-Bestand Stadtwald Greding
Beispielbestände mit Edellaubholz
Edelkastanie-Jungbestand im Gemeindewald Röttenbach
Vorangegangene Maßnahmen
Als Schutz vor Wildverbiss wurde nach der Pflanzung ein Zaun gebaut. Ansonsten war wenig Kulturpflege erforderlich, da die Edelkastanie in der Jugend sehr schnell wächst. Es wurden einzelne vorwüchsige, qualitativ gute „Zielbaumanwärter“ geastet (max. alle 6 Meter ein Baum). Bei der Wertastung wurde darauf geachtet, die Äste nicht zu nah am Stamm abzuschneiden. Eine Verletzung der Rinde muss unbedingt vermieden werden! Weiterhin wurde an Einzelstämmen ein Zwieselschnitt vorgenommen: an Kastanien mit zwei Leittrieben (Zwiesel) wurde der jeweils Schwächere abgeschnitten.
Besonderheit
Das Holz der Edelkastanie zählt zu den dauerhaftesten in Europa. Verwendungsbereiche ergeben sich somit auch ohne Schutzmittel im Außenbereich. Gängige Verwendung findet Sie in der Lawinenverbauung, als Rebpfähle im Weinbau oder auch als Terrassenbelag.
Durch ihr schnelles, gerades Wachstum macht sich der Anbau dieser Baumart rasch bezahlt. Auch die ersten Früchte lassen nicht lange auf sich warten. Nach ca. 10 Jahren können die ersten geerntet werden. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die primär auf Holzertrag gezüchteten Waldkastanien weniger und kleinere Maronen liefern als die Kultursorten.
Anfahrt
Von Röttenbach (Mittelfranken) an der B2 nach Niedermauck fahren. In Niedermauck befindet sich auf rechter Hand die Kirche. Direkt hinter der Kirche rechts abbiegen und links in Richtung der Furt halten. Die Furt überqueren, nach ca. 450 Metern finden Sie den Kastanien-Bestand (Abb.: blau) rechts des Weges. Von der Kirche aus befindet sich auch etwas weiter eine kleine Brücke über den Bach, falls Sie die Furt zum Überqueren zu viel Wasser führt. Bitte innerorts parken.
Lageplan - BayernAtlas 
Bergahorn-Kirsche-Hainbuche im Stiftungswald K und R bei Vorra
Vorangegangene Maßnahmen
Bis zum Alter von 20 Jahren wurden nur vereinzelt krumme und astige Bäumchen entnommen.
Zur besseren Bewirtschaftung wurde 2018 die Feinerschließung angelegt. Hierzu hat man alle 25 Meter eine Rückegasse angelegt.
2018 wurde alle 8 - 12 Meter ein zukünftiger Wertträger ausgewählt und mit einem Band dauerhaft markiert. Anschließend wurden um direkten Umfeld dieser die jeweils zwei bis drei stärksten Bedränger (mit Blick auf den Kronenraum) entnommen, um das Wachstum der Wertträger zu sichern und weiterhin zu fördern. In den Bereichen zwischen den Wertträgern erfolgten keine Maßnahmen.
Besonderheit
Der füllige Nebenbestand aus Hainbuche bedingt die schon jetzt erkennbare gute Qualität einzelner Ahorn- und Kirschenstämme.
Indem nur der Stamm vom Nebenbestand beschattet wird, sterben die hier nun nicht mehr gebrauchten Äste ab und fallen danach zügig ab. Im Anschluss wächst astfreies Holz nach. So wird astreines, gefragtes Wertholz produziert.
Um die pflegende Funktion des Nebenbestandes weiterhin zu gewährleisten, empfiehlt es sich, diesen in einer kleineren Größe als den Hauptbestand (Ahorn, Kirsche) zu pflanzen. Der Nebenbestand darf nämlich den wertvollen Ahornen und Kirschen nicht in die Krone wachsen und diese bedrängen.
Anfahrt
Am Westrand von Vorra (Nürnberger Land) in Richtung Stöppach fahren. Gleich nach Ende des Waldes auf der linken Seite in den Feldweg einfahren und hier parken. Dem Weg an der Wald-Feldgrenze 400 Meter folgen, bis Sie auf den ersten Waldweg linker Hand stoßen. In diesen einbiegen und ihm etwa 120 Meter folgen, bis er sich gabelt. Nehmen Sie den rechten Weg der oberhalb der Hangkante verläuft. Nach weiteren 300 Metern befindet sich der Musterbestand auf der linken Seite.
Lageplan - BayernAtlas 
Eiche-Elsbeere im Privatwald bei Allersberg
Vorangegangene Maßnahmen
Zum Schutz der Naturverjüngung vor Wildverbiss wurde vor längerer Zeit ein Zaun um die Fläche gebaut. So konnte sich der in Teilen sehr füllige Nebenbestand von Hainbuche, Feldahorn und Elsbeere ungestört entwickeln.
Dieser Nebenbestand von Hainbuche und Feldahorn dient dazu die Eichenstämme zu beschatten. Nur über diese Stammbeschattung lässt sich bei der Eiche astfreies und wertvolles Holz erzeugen.
In den letzten Jahren wurden hauptsächlich geschwächte und abgestorbene Kiefern entfernt.
Besonderheit
Die Elsbeere ist eine Halbschattbaumart. Sie verträgt in ihrer Jugend ein hohes Maß an Überschattung, braucht aber bald mehr Licht, um ihr Potential entfalten zu können. Diese Baumart bildet in 30 Metern Ausdehnung um den Mutterbaum herum eine sogenannte „Wurzelbrut“ aus, mit welcher sie sich vegetativ fortpflanzt. So werden in dunkleren Bereichen aus den „Ablegern“ neue Jungbäume. Samen bildet die Elsbeere erst dann vermehrt aus, wenn die Krone viel Licht hat.
Anfahrt
Von Allersberg nach Norden in Richtung Harrhof fahren (Staatsstraße 2225). Der Beschilderung folgen und die erste Abbiegung rechts nach Harrhof nehmen. In Harrhof der ersten Straßenbiegung nicht nach rechts folgen, sondern leicht links/geradeaus halten. Nach 60 Metern biegt ein Feldweg nach links ab. Hier kann geparkt werden. Folgen Sie dem Feldweg etwa 150 Meter. Auf der linken Waldseite befindet sich der Musterbestand.
Lageplan - BayernAtlas 
Erstaufforstung mit Ahorn und Linde bei Treuchtlingen
Vorangegangene Maßnahmen
1992 wurde hier auf einer Fläche von ca. 1,6 Hektar Ackerland ein Waldbestand mit Ahorn und Linde im Nebenbestand erst-aufgeforstet. Dieser wurde seither kontinuierlich gepflegt, wobei in einem ersten Eingriff nur Grobformen, die schädigend auf andere Bestandsglieder gewirkt haben, zurückgenommen wurden. In diesem Zuge wurde auch die systematische Erschließung des Bestands durch die Anlage von Rückegassen vollzogen.
In einem späteren Pflegedurchgang von 2009/2010 wurden bereits die Kandidaten für spätere Auslesebäume markiert und konsequent gefördert, indem ihre direkten Bedränger entnommen wurden. 2018/2019 wurde diese Maßnahme wiederholt, da sich inzwischen das Kronendach wieder geschlossen hatte und die Kandidaten wegen des Kronenzuwachses im Bestand von neuen Bedrängern eingeengt waren.
Lage des Bestandes
Besonderheiten
Im Rahmen von Lehrveranstaltungen wurden Zwieselschnitte und Wertastungen vorgenommen, die zu der hervorragenden Qualität in diesem Bestand beigetragen haben. Die konsequente und rechtzeitige Begünstigung der besten Individuen hat dazu geführt, dass diese ihren Zuwachs bereits jetzt sichtbar gesteigert haben und eine Wertholzernte im Alter von ca. 80 Jahren versprechen.
Hierzu ist es wichtig, weiterhin konsequent zu pflegen / durchforsten, um die Kronen kräftig und vital zu erhalten. Bei den Ahornarten kann die starke Wuchsleistung in der Jugend nur durch rechtzeitige Pflege genutzt werden. Bei einem Alter von 40 Jahren kulminiert der Zuwachs, die Wuchsleistung der Ahorne nimmt ab diesem Zeitpunkt bereits ab. Dadurch können Verluste aus der Jungbestandsphase in höherem Bestandsalter nicht wieder aufgeholt werden.
Anfahrt
Von der B2 auf die St2217 Richtung Langenaltheim abbiegen, nach 1,7 km folgt eine große Linkskurve. Nach weiteren 150 Metern nach der Linkskurve links abbiegen Richtung Altheimersberg. Der Straße 1,4 km nach Norden folgen. Hier kurz nach Beginn des Waldes rechts in den Forstweg abbiegen und parken, nach ca. 50 Metern befindet sich der Bestand auf der rechten Seite (Süden)
Lageplan - BayernAtlas 
Hochwertige Erstaufforstung mit Bergahorn bei Schnaittach
Bestandesbeschreibung
Auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche wurde hier 1985 eine Erstaufforstung mit Bergahorn und einem Buchennebenbestand hinter Zaun durchgeführt. Das Pflanzenverhältnis zur Zeit der Kulturbegründung betrug 4:1 (Bergahorn zu Buche). Der Nebenbestand ist auch heute noch vorhanden und kann seine dienende Funktion ausüben. Der Bestand ist zudem durchsetzt mit einzelnen Mischbaumarten, wie z.B. der Vogelkirsche, welche integriert und erhalten werden. Die Fläche ist zwischen landwirtschaftlichen Flächen am Rand eines Fichtenbestandes gelegen und gut über Feld- und Flurbereinigungswege zu erreichen.
Besonderheiten
Der Bestand wurde bisher sehr konsequent gepflegt, was sich an den vielen auffallend gut gewachsenen Einzelbäumen zeigt. Ein derart hoher Anteil gut gewachsener Individuen ist besonders bei Erstaufforstungen nicht die Regel. In Hinblick auf die Größe der Fläche ist auch eine ausreichende Zahl an zukünftigen Wertträgern, sogenannten Z(ukunfts)-Bäumen, vorhanden und somit eine sinnvolle waldbauliche Behandlung möglich. Der Bestand veranschaulicht bespielhaft, welche Ergebnisse beim Bergahorn durch angemessene waldbauliche Behandlung erzielt werden können. Es ist davon auszugehen, dass sich im vorliegenden Bestand in Zukunft einzelne stark dimensionierte und qualitativ hochwertige Individuen herausbilden werden.
Vorangegangene und geplante Maßnahmen
Im Anschluss an die Pflanzungen im Jahr 1985 wurden bereits 1995 erste Pflegemaßnahmen durchgeführt. Dazu wurden zunächst im Rahmen einer sogenannten Negativauslese unerwünschte Wuchsformen entnommen: Tiefzwiesel und Grobformen, welche umliegenden Bäumen in großem Maße Ressourcen nehmen, dabei aber selbst nur schlechte Qualitäten ergeben. Im Jahr 2004 erfolgte die erste Auslesedurchforstung. Dabei wurden die jeweils am besten veranlagten Individuen begünstigt, das heißt: gezielt Entnahme einzelner Bäume im direkten Umgriff dieser Individuen um dadurch Ressourcen wie vor allem Platz, Wasser und Nährstoffe freizugeben. Somit lassen sich auf lange Sicht sowohl der Zuwachs als auch die Wertsteigerung auf einzelne vielversprechende Exemplare fokussieren. 2016 folgte eine weitere Auslesedurchforstung nach demselben Schema. Diese wird auch in Zukunft fortgeführt werden.
Anfahrt
Von Bondorf in Richtung Osternohe fahrend kurz vor der Kirche auf der Straße „An der Osternohe“ nach links (Westen) in den ausgebauten Flurbereinigungsweg abbiegen, diesem etwa 50 Meter folgen und nach rechts in den Feldweg (zweite Abbiegung) abbiegen. Nach weiteren etwa 50 Metern liegt im direkten Umgriff einer Scheune der Bestand zur linken Seite (Süden) des Weges.
Lageplan - BayernAtlas 
Beispielbestände mit Nadelholz
Schwarzkiefer im Privatwald bei Thalmässing
Vorangegangene Maßnahmen
Mit der Pflanzung im Jahr 1985 wurde ein Zaun zum Schutz gegen Wildverbiss aufgestellt. In den folgenden Jahren wurden ausgefallene Schwarzkiefern durch Lärchen und Buchenwildlinge ersetzt. Die kleinen Buchenwildlinge wurden an anderer Stelle aus dem eigenen Wald mit ein wenig Erde gewonnen.
Die Kulturpflege bestand in der ersten Zeit aus der Entfernung von zu hohem Gras um die Pflänzchen. Sobald die Bäumchen der Verbisshöhe entwachsen waren, konnte der Zaun entfernt werden. In der Dickungsphase wurden kontinuierlich einzelne vom Nassschnee umgebogene Kiefern entfernt. Dies stabilisierte die schwächlichen Kiefern durch etwas mehr Standraum. 2018 wurde der Bestand vom Revierleiter zusammen mit dem Waldbesitzer ausgezeichnet. Die rot markierten Bäume werden zugunsten gut geformter, vitaler Zukunftsbäume entnommen. Diese „Zukunftsbäume“, die zukünftigen Wertträger des Bestandes, wurden im Abstand von 5 - 10 Metern mit blauem Band markiert. Im Anschluss wurden diese Zukunftsbäume vom Waldbesitzer geastet. Der Waldbesitzer möchte in Zukunft noch eine Stufe höher asten als bisher erfolgt.
Besonderheit
Vor diesem Schwarzkiefernbestand stockten alte Hutefichten auf dem sehr kalkreichen Boden. Diese Fichten waren größtenteils rotfaul. Rotfäule ist auf Pilze (Gemeiner Wurzelschwamm) zurückzuführen, die das Holz stabilisierende Lignin zerstören – übrig bleibt nur die flexible, weiße Zellulose. Diese Art der Weißfäule hat ihr Wuchsoptimum auf basen- bzw. kalkreichen Böden. Für Rotfäule anfällige Fichten und Douglasien sollten deswegen nicht auf Kalkböden gepflanzt werden.
Anfahrt
Von Reinwarzhofen (Markt Thalmässing) kommend in Richtung Dannhausen befindet sich auf rechter Seite eine Funkturmanlage. Hier bitte einbiegen. Bei der Abzweigung nach Ohlangen links halten. Nach etwa 600 Metern scharf rechts abbiegen und dem Weg in den Wald folgen. Am Wald-/Feldrand bitte parken. Nach weiteren 400 Metern links einem Erdweg entlang einer Wald-Wiesengrenze zum Musterbestand folgen. Der Bestand befindet sich auf der rechten Seite.
Lageplan - BayernAtlas 
Douglasie-Rotbuche im Privatwald bei Hersbruck
Vorangegangene Maßnahmen
Aufgrund schlechter Erschließung und der steilen Hanglage wurde hier in den letzten Jahren nicht viel Forstwirtschaft betrieben. Grundsätzlich wird in dieser späten Phase des Bestandes das Augenmerk nur auf die Besten Einzelbäume gerichtet. Die Kronen dieser „Zielbäume“ werden in ihrem Wachstum gefördert, indem man kontinuierlich, in geeigneten Abständen, umliegende Bedränger entnimmt: minder veranlagte Exemplare, welche den Zukunftsbäumen in den Kronenraum wachsen und Ressourcen streitig machen. Durch deren gezielt Entnahme kann der einzelne Qualitätsbaum schnell an Masse zulegen. Dies geschieht nur, wenn die Krone Platz hat und nicht von anderen Bäumen bedrängt wird.
Besonderheit
In ihrer Jugend ist die Douglasie sehr empfindlich (v.a. Verfegen durch Rehböcke, Frosttrocknis). Sie besticht aber durch schnelles Höhen- und Dickenwachstum. Die Douglasien am Steinberg wurden um 1890 angebaut. Diese Bäume gehören somit zu den ersten Anbauten und ältesten Douglasien in Bayern. Astungswürdig sind qualitativ gute und wüchsige Bestände, wie diese hier auf Eisensand-Böden. Geastet wird ab „Maßkrugstärke“ des Stämmchens, dabei aber stets nur die am besten veranlagten Individuen. Bestände mit erhöhten Risiken, z. B. Sturmwurf, Rotfäule, Schneebruch, u.a. werden nicht geastet. Pro Hektar sollen höchstens 100 verteilte, vitale und qualitativ vielversprechende Douglasien geastet werden; in der Regel sind es aber meist deutlich weniger.
Anfahrt
Von Hersbruck Richtung Großviehberg fahren. Kurz vor Großviehberg befindet sich auf der rechten Seite eine Feld-/Wiesenfläche mit Parkmöglichkeit – hier bitte parken. Nach 150 Metern Fußmarsch auf der Straße zurück nach Hersbruck, befindet sich links hangabwärts ein Wanderpfad. Diesem 170 Meter folgen. Die starken Douglasien befinden sich direkt links am Pfad neben einem kleinen Quellaustritt.
Lageplan - BayernAtlas 
Schwarzkiefer-Fichte-Rotbuche im Kommunalwald Greding
Bestandesbeschreibung
Der Waldbestand wird aus verschiedensten Baumarten gebildet und erstreckt sich über ca. 1,9 Hektar. Neben den heimischen Baumarten Rotbuche, Fichte und Kiefer, kommen hier Schwarz-Kiefern, die ihren Ursprung in den Mittelmeer-Regionen haben, vor. Die Schwarz-Kiefer wird vor allem im Klimawandel als zukunftsweisende Baumart angesehen. Das Bestandesalter über alle Baumarten hinweg wird auf 125 - 140 Jahre geschätzt. Der Bestand ist auf der kompletten Fläche mit den Baumarten Rotbuche und Spitzahorn vorausverjüngt. Ebenso werden sich auch einzelne Fichten und Kiefern in der Verjüngung halten. Der Bestand weist eine Vielzahl an Biotopbäumen auf. Weitere ökologische Merkmale sind die in den letzten Jahren angereicherten Totholzmengen, sowohl stehend als auch liegend. Der Waldbestand liegt im südlichen Jura und ist an einem südlich exponierten Steilhang angelegt. Daraus ergibt sich die Einstufung als Bodenschutzwald und Erholungswald der Stufe 2.
Vorangegangene Maßnahmen
In den letzten Jahren wurden verstärkt abgängige Fichten entnommen. Grund hierfür waren zumeist Borkenkäferbefälle, Trockenschäden und Windwürfe. Auch einzelne Waldkiefern mussten aufgrund von Trockenschäden und der Kiefernchlorose im Rahmen des Waldschutzes entnommen werden. In der Rotbuche gab es in den vorangegangen Jahren Einzelentnahmen, vor allem, um Licht für die bereits in den Startlöchern stehenden Verjüngung zu schaffen.
Zukünftige Maßnahmen
In den nächsten Jahren sollen weiterhin vor allem zwischenständige Buchen entnommen werden, um weiter die junge Buche und den Spitzahorn in den Altbestand zu überführen. Ebenso ist davon auszugehen, dass sich die Fichten und Waldkiefern aufgrund von Borkenkäferbefällen, Kiefernchlorose und Trockenschäden weiter aus dem Bestandesbild verabschieden werden und infolgedessen aktiv entnommen werden müssen.
Anfahrt
Von Kraftsbuch aus am nördlichen Ortsausgang (Richtung Greding) nach rechts in Richtung Heimbach abbiegen. Der Straße 1,7 km folgen, rechts (Süden) der Straße findet sich eine Parkmöglichkeit. Überqueren Sie Straße (spärlich befahren) noch Norden und folgen Sie dem Forstweg in den Wald hinein. Nach 220 Metern biegen Sie rechts in den unteren der beiden Wege ab und folgen dem Waldweg entlang den Wiesen. Nach etwa 750 Metern biegen Sie links an einer Gedenksäule und einer Bank hangaufwärts in den Wald ein. Der Bestand befindet sich vor Ihnen.
Lageplan - BayernAtlas 
Fichten-Douglasien Erntebestand bei Absberg
Bestandesbeschreibung
Die Bestandesfläche beträgt ca. 1,16 Hektar. Die Hauptbaumarten des Bestandes sind Fichte und Douglasie. Dabei nimmt die Fichte den größten Anteil der Bestandesfläche in Anspruch. Das Bestandesalter liegt zwischen 80 - 120 Jahren. Die Douglasien weisen hier eine hohe Vitalität und Qualität auf, wodurch sie sich für einen Erntebestand qualifiziert. Die punktuell ausscheidende Fichte, oft stärkerer Dimensionen, ist bisher nicht noch prägend am Bestandesbild beteiligt. Jedoch ist davon auszugehen, dass sie hier durch die klimatischen Veränderungen und kalamitätsbedingten Ausfälle, die auch heute schon ersichtlich sind, auf lange Sicht aus dem Altbestand verschwinden wird. Der Waldboden des Bestandes weist eine hohe Vegetationsvielfalt auf. Unter anderem finden sich hier Brombeersträucher, Klettenlabkraut und verschiedenste Farne. Zusätzlich dazu stellt sich in lückigen Bereichen bereits vereinzelt eine Naturverjüngung aus Rotbuche, Weißtanne und Douglasie ein.
Vorangegangene Maßnahmen
In den vorangegangenen Jahren mussten aus Kalamitätsgründen vereinzelt Fichten entnommen werden. Bis dato konnten jedoch großflächige Einschläge aufgrund zügiger Käferholzaufarbeitung verhindert werden. Ebenso wurden punktuell einzelne Durchforstungseingriffe zur Kronenpflege in der Fichte durchgeführt.
Zukünftige Maßnahmen
In naher Zukunft sollen weitere einzelstammweise Eingriffe in der Fichte zur Kronenpflege und zur Anreicherung der Naturverjüngung durchgeführt werden. Hierbei soll aber vor allem auf den Erhalt der gesamten Bestandesstabilität geachtet werden.
Anfahrt
Von Absberg kommend Richtung Igelsbach liegt der Musterbestand auf der westlichen Seite der Ortsverbindungsstraße Absberg-Igelsbach nach etwa 800 Metern entlang der Igelsbacher Steige. Am Ende der Serpentine (bergabwärts) an der Linkskurve beim Warnschild rechts in den Waldweg abbiegen, dort bitte am Wegrand parken. Zu Fuß etwa 50 Meter den Weg zurück bergauf folgen (Achtung gelegentlicher Verkehr), dort liegt der Bestand hangaufwärts auf der rechten Seite (Südwest).
Lageplan - BayernAtlas 
Wiederaufforstung mit Atlaszedern aus Frankreich bei Leinburg
Bestandesbeschreibung
Auf einer Fläche von 0,1 Hektar wurde hier im Wald der Gemeinde Leinburg ein Anbauversuch mit der Baumart Atlaszeder begründet. Im Pflanzverband von 2 x 2 Metern wurden 250 Exemplare aus dem Herkunftsgebiet Frankreich im Jahr 2019 hinter Zaun ausgebracht. Ein dienender Nebenbestand ist bei der Atlaszeder nicht notwendig. Vereinzelt vorkommende Mischbaumarten, wie zum Beispiel der Bergahorn werden mit am Bestand beteiligt.
Lage des Bestandes
Besonderheiten
Auffallend sind zunächst die gute Wuchsleistung der Zedern, mit teilweise bis zu einem halben Meter Höhenzuwachs und die insgesamt überzeugende Qualität der Stammformen. Die Atlaszeder scheint sehr gut dazu in der Lage, sich auch selbst durch sogenannte innerartliche Konkurrenz zu differenzieren, das heißt: in Hinblick auf Vitalität und Wuchsform genetisch gut veranlagte Individuen bilden sich von selbst relativ zügig heraus.
Zukünftige Maßnahmen
Im weiteren Verlauf werden die Atlaszedern noch ein paar Jahre im Zaun verbleiben, bis auch die letzten Exemplare der Verbisshöhe des Rehwildes (ca. 1,3 Meter) entwachsen sind. Danach wird der Zaun abgebaut. Ebenso verhält es sich mit dem Ausmähen der Fläche: auf der Anbaufläche kann der Begleitwuchs während der Vegetationszeit beachtliche Höhen erreichen. Also heißt es auch hier: dranbleiben, bis die Kultur vollständig gesichert ist.
Auf längere Sicht hin wird der Kleinbestand auf dieselbe Weise wie auch andere Nadelholzkulturen behandelt werden: erste Entnahmen im Rahmen der Jungdurchforstung zur gezielten Förderung besonders gut veranlagter Individuen, sogenannter Z(ukunfts)-Bäume.
Anfahrt
In Weißenbrunn (im Nürnberger Land) der „Weißenbrunner Hauptstrasse“ folgend nach Norden in die „Winner Straße“ abbiegen. Nach Norden verlaufend rechts in den ersten Forstweg nach Verlassen der Ortschaft einbiegen und diesem bis nach der starken Rechtskurve folgen. Kurz nach dieser Rechtskurve links abbiegen und der Forststraße bis zur nächsten großen Rechtskurve folgen. Dort liegt der Bestand westlich des Weges in unmittelbarer Nähe.
Lageplan - BayernAtlas 
Sicherlich sind Ihnen in den letzten Jahren vermehrt abgestorbene Bäume in Bayerns Wäldern aufgefallen oder Sie haben davon gehört. Die Borkenkäferarten Buchdrucker und Kupferstecher sind ein typisches Beispiel von weit verbreiteten Schädlingen an der Fichte. In Kombination mit Sturmwürfen und Trockenjahren kommt es in wärmeren Gebieten regelmäßig zu Massenvermehrungen und damit zu übermäßigem Anfall von wertgemindertem Holz. Holzentwertung, Überangebot auf dem Holzmarkt und sinkende Holzpreise sind immer öfter die leidigen Folgen.
Auch unsere Waldkiefer beginnt diesem Trend zu folgen. Vor allem in Mittel-, Ober- und Unterfranken zeigen sich vermehrt nach trockenen Sommern (2003, 2015, 2018) und an sonnigen Waldrändern größere Ausfallerscheinungen.
Die Zunahme dieser Schäden in unseren Wäldern ist zumeist auf eine höhere Anfälligkeit der Bäume gegenüber Schaderregern im Zuge der Klimaerwärmung zurückzuführen. Die hierzulande angebauten Fichten und Kiefern vertragen kältere Temperaturen besser als wärmere. Dies zeigen schon die natürlichen Verbreitungsgebiete dieser Baumarten (Bergland und nördliche Breiten). Der Klimawandel steht zwar erst in den Startlöchern, aber schon jetzt reagieren die häufigsten Baumarten Bayerns Wälder (Fichte und Kiefer) negativ auf einen Trend, der sich weiter fortsetzen wird. Mancherorts kämpft man bereits auch um den bloßen Walderhalt (Beispiel Frankenwald) – aus grünen Wäldern werden brache Kahllandschaften.
Um den unausweichlichen Veränderungen unserer Wälder Rechnung zu tragen und den bevorstehenden Schäden zuvorzukommen, empfiehlt es sich bereits jetzt in gefährdeten Beständen vorausschauend aktiv zu werden. Dazu stehen angepasste Waldbaumethoden sowie ein umfangreiches Portfolio an klimatoleranten Baumarten zur Verfügung. Mit tatkräftiger Unterstützung der Bayerischen Forstverwaltung, repräsentiert durch Ihre zuständigen Revierleitenden vor Ort, ist der erste Schritt zum Waldumbau zudem leicht gemacht, frei nach dem Motto: „Besser Vorsorge treffen, als den Schäden hinterherzurennen.“
Weitere Informationen
Katalog "Waldumbau zum Anfassen" zum Herunterladen (Stand 2019, Aktualisierung in Arbeit):
Weitere Seiten zum Thema Waldumbau im Klimawandel